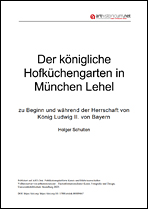
zu Beginn und während der Herrschaft von
König Ludwig II. von Bayern
In den Jahren 1868 und 1869 erfolgten durch König Ludwig II. von Bayern beachtliche Ausgaben für den Umbau zweier Treibhäuser für Erd- und Himbeeren im Hofküchengarten in München Lehel. Diese Ausgaben tätigte König Ludwig II. während des Umbaus und der Neugestaltung seiner (oberen) Wohnung in der obersten Etage des nordwestlichen Eckpavillons der Münchner Residenz sowie des Baues des daran anschließenden Wintergartens auf dem Dach des Westflügels des „Festsaalbaues“. Im Jahr 1871 folgten Ausgaben für den Bau zweier zusätzlicher Gewächshäuser im Blumentreib(haus)garten, ebenfalls in München Lehel.
Weder zum – nicht mehr erhaltenen – Hofküchengarten in München Lehel zur Zeit König Ludwigs II. noch zum – ebenfalls nicht mehr erhaltenen – Blumentreib(haus)garten liegen bisher umfangreichere Publikationen vor. In der Studie finden sich einige, zum Teil erste Informationen zur räumlichen Entwicklung des Hofküchengartens in München Lehel im 19. Jahrhundert, zur Geschichte des Hofküchengartens in München Lehel im 18. Jahrhundert, zu den namentlich bekannten Hofküchengärtnern, zu den Hofküchengärten beim Schloss Nymphenburg und in München Lehel, zum Ende des Hofküchengartens in München Lehel, zum Blumentreib-(haus)garten in München Lehel, zum Hofküchengärtner in München Lehel zur Zeit König Ludwigs II. und schließlich zu Obst und Gemüse aus dem Hofküchengarten für die Hofküche und damit auch besonders für die „öffentliche“, königliche Hoftafel.
Ergänzend gibt es vier Anhänge, zum Beispiel Transkriptionen von Angaben zu kurfürstlichen und königlichen Hofgärten und Hofgärtnern aus Hof- und Staatskalendern sowie und Hof- und Staatshandbüchern der Jahre 1738 bis 1886.
Die Studie möchte vor allem zur breiteren und vertieften Forschung zum behandelten Themenkomplex – auch als ein Beispiel eines wichtigen Elements herrscherlicher Repräsentation – anregen.
Die Studie umfasst mit vier Anhängen und Abbildungen 262 Seiten,
2025 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg
Weder zum – nicht mehr erhaltenen – Hofküchengarten in München Lehel zur Zeit König Ludwigs II. noch zum – ebenfalls nicht mehr erhaltenen – Blumentreib(haus)garten liegen bisher umfangreichere Publikationen vor. In der Studie finden sich einige, zum Teil erste Informationen zur räumlichen Entwicklung des Hofküchengartens in München Lehel im 19. Jahrhundert, zur Geschichte des Hofküchengartens in München Lehel im 18. Jahrhundert, zu den namentlich bekannten Hofküchengärtnern, zu den Hofküchengärten beim Schloss Nymphenburg und in München Lehel, zum Ende des Hofküchengartens in München Lehel, zum Blumentreib-(haus)garten in München Lehel, zum Hofküchengärtner in München Lehel zur Zeit König Ludwigs II. und schließlich zu Obst und Gemüse aus dem Hofküchengarten für die Hofküche und damit auch besonders für die „öffentliche“, königliche Hoftafel.
Ergänzend gibt es vier Anhänge, zum Beispiel Transkriptionen von Angaben zu kurfürstlichen und königlichen Hofgärten und Hofgärtnern aus Hof- und Staatskalendern sowie und Hof- und Staatshandbüchern der Jahre 1738 bis 1886.
Die Studie möchte vor allem zur breiteren und vertieften Forschung zum behandelten Themenkomplex – auch als ein Beispiel eines wichtigen Elements herrscherlicher Repräsentation – anregen.
Die Studie umfasst mit vier Anhängen und Abbildungen 262 Seiten,
2025 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg

in der Münchner Residenz (1800-1833)
und die nachfolgende Nutzung des Gebäudes bis 1957
Das evangelische "Hofbethaus" in der Münchner Residenz war von 1800 bis 1833 der einzige Ort evangelisch-lutherischer Gottesdienste für die Hofgemeinde sowie für alle anderen in München lebenden, evangelischen Christen.
Es befand sich in einem umgebauten "Ballhaus" aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Mit dem Umbau wurde im Herbst 1799 Maximilian von Verschaffelt beauftragt.
Nach einem Umzug der evangelischen Pfarr- wie auch der Hofgemeinde in eine neu erbaute Kirche im Jahr 1833 wurde das Gebäude nach einem Umbau 1834/35 und dem Wiederaufbau 1945/46 zweimal anderweitig weiter genutzt.
Durch eine genaue Betrachtung der wenigen Bildquellen in Kombination mit einer Reihe verschiedener Schriftquellen wird versucht, ein genaueres Bild vom ehemaligen Gebäude und von der Gestaltung und Ausstattung der evangelischen Hofkapelle zu zeichnen - als weiterer kleiner Beitrag für zukünftige Forschung.
Die Studie mit Abbildungen umfasst 64 Seiten,
2024 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg
Die Studie mit Abbildungen umfasst 64 Seiten,
2024 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg
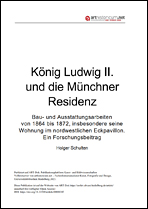
Bau- und Ausstattungsarbeiten von 1864 bis 1872, insbesondere seine Wohnung im nordwestlichen Eckpavillon.
Ein Forschungsbeitrag
Von der (oberen) Residenzwohnung werden neben
den bisher mehr oder weniger bekannten fünf Haupträumen auch Nebenräume
erstmalig etwas genauer besprochen. Dabei hat die Auswertung von Archivalien neue
Erkenntnisse unter anderem zu beteiligten Künstlern und Kunsthandwerkern,
zu Bau- und Ausstattungsphasen, zu Dekor und Ausstattung, zu Kosten und zur Nutzung
ergeben. Auf Basis neuer Erkenntnisse wird etwa unter anderem vorgeschlagen,
die „Hofgartenzimmer“ als „untere“ Residenzwohnung von König Ludwig II.
zu bezeichnen.
Neben möglichst genauen Beschreibungen der wandfesten Dekors sowie der mobilen Ausstattung und Dekoration der Räume der (oberen) Münchner Residenzwohnung werden Elemente der Gestaltung und Ausstattung zudem mit der Gestaltung und Ausstattung von Räumen in den drei erhaltenen Schlössern Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein, sowie in Schloss Berg verglichen. Zur Kenntnis und zum Verständnis der (oberen) Münchner Residenzwohnung König Ludwigs II. von Bayern versucht die Studie damit, nach grundlegenden Publikationen der 1980er Jahre, einen weiteren, bescheidenen Forschungsbeitrag zu leisten.
Die Studie umfasst 426 Seiten in zwei Bänden: Text (325 Seiten), Abbildungen (101 Seiten).
2023 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg
Neben möglichst genauen Beschreibungen der wandfesten Dekors sowie der mobilen Ausstattung und Dekoration der Räume der (oberen) Münchner Residenzwohnung werden Elemente der Gestaltung und Ausstattung zudem mit der Gestaltung und Ausstattung von Räumen in den drei erhaltenen Schlössern Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein, sowie in Schloss Berg verglichen. Zur Kenntnis und zum Verständnis der (oberen) Münchner Residenzwohnung König Ludwigs II. von Bayern versucht die Studie damit, nach grundlegenden Publikationen der 1980er Jahre, einen weiteren, bescheidenen Forschungsbeitrag zu leisten.
Die Studie umfasst 426 Seiten in zwei Bänden: Text (325 Seiten), Abbildungen (101 Seiten).
2023 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg

Im Oktober 1829 wurden zwei Abschnitte der Hofgartenarkaden
mit sechzehn Wandbildern zur bayerischen Geschichte für das Publikum
geöffnet – gemalt von Schülern von Peter Cornelius.
Im ersten Teil dieser Studie steht der ehemalige Gesamtdekor im Zentrum. Zum Arbeitsablauf von 1826 bis 1829 erlauben neu ausgewertete Quellen interessante Ergänzungen zum bisherigen Wissensstand. Erstmals wird die ursprüngliche Deckenbemalung genauer vorgestellt. Ein Schriftwechsel zwischen Cornelius und König Ludwig I. gibt Einblick in die Genese der Bild-Titel. Zeitgenössische Beschreibungen und Kritiken erlauben außerdem zumindest eine gewisse Vorstellung der heute verlorenen Allegorien.
Die unterschiedliche Qualität der heute sichtbaren Wandbilder drängt zudem die Frage nach dem Erhaltungszustand auf. Im zweiten Teil werden daher erstmals ausführlich die Zerstörungen und „Restaurierungen“ bis zum letzten großen Eingriff 1971/72 behandelt.
Im dritten Teil zeigt dann das exemplarisch herausgegriffene Bild zur bayerischen Verfassung bewusste Abweichungen vom tatsächlichen Geschehen. Dabei wird die Notwendigkeit deutlich, bei einer etwaigen gleichmäßigen Behandlung aller Historienbilder das Gemalte jeweils kritisch sowohl mit den historischen Fakten als auch mit dem damaligen Geschichtswissen zu vergleichen.
Abschließend bietet der vierte Teil Fotografien der erhaltenen Historienbilder und Allegorien mit Informationen zu Technik und Maßen, zum Zustand und ursprünglichem Kontext, zu den dargestellten Inhalten, zur Genese des Bildtitels und zum Maler.
Die Studie umfasst 100 Seiten, 39 Abb., 22 Fig.
2006 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg
Im ersten Teil dieser Studie steht der ehemalige Gesamtdekor im Zentrum. Zum Arbeitsablauf von 1826 bis 1829 erlauben neu ausgewertete Quellen interessante Ergänzungen zum bisherigen Wissensstand. Erstmals wird die ursprüngliche Deckenbemalung genauer vorgestellt. Ein Schriftwechsel zwischen Cornelius und König Ludwig I. gibt Einblick in die Genese der Bild-Titel. Zeitgenössische Beschreibungen und Kritiken erlauben außerdem zumindest eine gewisse Vorstellung der heute verlorenen Allegorien.
Die unterschiedliche Qualität der heute sichtbaren Wandbilder drängt zudem die Frage nach dem Erhaltungszustand auf. Im zweiten Teil werden daher erstmals ausführlich die Zerstörungen und „Restaurierungen“ bis zum letzten großen Eingriff 1971/72 behandelt.
Im dritten Teil zeigt dann das exemplarisch herausgegriffene Bild zur bayerischen Verfassung bewusste Abweichungen vom tatsächlichen Geschehen. Dabei wird die Notwendigkeit deutlich, bei einer etwaigen gleichmäßigen Behandlung aller Historienbilder das Gemalte jeweils kritisch sowohl mit den historischen Fakten als auch mit dem damaligen Geschichtswissen zu vergleichen.
Abschließend bietet der vierte Teil Fotografien der erhaltenen Historienbilder und Allegorien mit Informationen zu Technik und Maßen, zum Zustand und ursprünglichem Kontext, zu den dargestellten Inhalten, zur Genese des Bildtitels und zum Maler.
Die Studie umfasst 100 Seiten, 39 Abb., 22 Fig.
2006 publiziert auf dem:
ART-DOK-Server der Universität Heidelberg

Die Doktorarbeit versucht einen Überblick über
die Geschichte der französischen Deckenmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts
anhand von Werkuntersuchungen in Paris und der Ile-de-France. Ausgehend
von den bedeutenden Raumgruppen in Profan- und Sakralbauten (Versailles
etc.) werden Theorie und Entwicklung der Dekorationssysteme etwa in Galerien,
Salons, Treppenhäusen, Appartements, Parlements. Theatern, Zentralbaukirchen,
Langshauskirchen etc. untersucht.
Dabei können viele gängige Thesen, etwa zu den Bezügen zur italienischen Deckenmalerei, zur "Barockoffensive" unter Mazarin oder zur Bedeutung und Gestaltungsweise einzelner Maler präzisiert oder revidiert werden. Zu einer Reihe von Werken werden außerdem neue Erkenntnisse zur ehemaligen Gestalt und ihrer Bedeutung in der Entwicklung vorgelegt und die französische Deckenmalerei im Abschlußkapitel vor dem Horizont der europäischen Kunstlandschaft gewürdigt.
Die Teilkapitel sind dabei ganz bewußt als jeweils "eigenständige" Untereinheiten behandelt, so daß es problemlos möglich ist, sich bezüglich bestimmter Raumtypen ganz gezielt und unabhängig vom Rest zu informieren.
Erschienen 1999 im Verlag Peter-Lang, Reihe XXVIII (Kunstgeschichte), Bd. 342. 823 S., 41 Abb., 130 Fig.
Dabei können viele gängige Thesen, etwa zu den Bezügen zur italienischen Deckenmalerei, zur "Barockoffensive" unter Mazarin oder zur Bedeutung und Gestaltungsweise einzelner Maler präzisiert oder revidiert werden. Zu einer Reihe von Werken werden außerdem neue Erkenntnisse zur ehemaligen Gestalt und ihrer Bedeutung in der Entwicklung vorgelegt und die französische Deckenmalerei im Abschlußkapitel vor dem Horizont der europäischen Kunstlandschaft gewürdigt.
Die Teilkapitel sind dabei ganz bewußt als jeweils "eigenständige" Untereinheiten behandelt, so daß es problemlos möglich ist, sich bezüglich bestimmter Raumtypen ganz gezielt und unabhängig vom Rest zu informieren.
Erschienen 1999 im Verlag Peter-Lang, Reihe XXVIII (Kunstgeschichte), Bd. 342. 823 S., 41 Abb., 130 Fig.
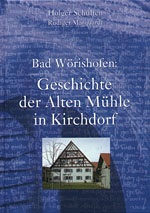
Die Geschichte der Alten Mühle in Kirchdorf reicht
zurück bis ins hohe Mittelalter. Dieses reich bebilderte Buch erzählt
auf 170 Seiten wie die Müller als Leibeigene und Lehensmannen lebten
und in der Mühle neben Korn vor allem Flachs bearbeiteten. Von vielen
Müllerfamilien wird berichtet: im 30jährigen Krieg, zur Zeit des
Rokoko und der Hungersnot von 1770, in den Wirren unter Napoleon, im 19.
und 20. Jahrhundert. Schließlich wird geschildert, wie die Mühle
1999 für die Zukunft "fit" gemacht wurde.
Das Buch entstand 2002 in einem knappen halben Jahr. Nach ersten Informationen im Januar erfolgten Literatur-, Quellensichtung und Archivarbeit unter der Maßgabe, dass im Juli eine fertige Publikation vorliegen solle. Die Geschichte der Mühle entpuppte sich dabei nicht nur 600 sondern 900 Jahre zurückreichend. Mit Bezügen zur "großen" Geschichte (Deutschland, Europa, Welt) und über 80 farbigen Bildern wurde versucht, die Geschichte wieder lebendig werden zu lassen.
Erschienen 2002, Feldafing, 173 S., 84 Abb.
Das Buch entstand 2002 in einem knappen halben Jahr. Nach ersten Informationen im Januar erfolgten Literatur-, Quellensichtung und Archivarbeit unter der Maßgabe, dass im Juli eine fertige Publikation vorliegen solle. Die Geschichte der Mühle entpuppte sich dabei nicht nur 600 sondern 900 Jahre zurückreichend. Mit Bezügen zur "großen" Geschichte (Deutschland, Europa, Welt) und über 80 farbigen Bildern wurde versucht, die Geschichte wieder lebendig werden zu lassen.
Erschienen 2002, Feldafing, 173 S., 84 Abb.

Im Auftrag des Vereins für Ostbairische Heimatforschung
erforschte ich für die Stadt Passau 1992 die Geschichte von über
vierzig Häusern der Altstadt. Basierend auf den Forschungsergebnissen
wurden in der Folge an diesen Häusern Gedenktafeln angebracht.
Neben einer Fülle neuer Erkenntnisse zur Geschichte, der wechselnden Baugestalt - soweit sich diese anhand von Quellenmaterial und Akten des Bauamtes nachvollziehen und belegen läßt - sowie zur Geschichte bedeutender Bewohner, bestand ein wichtiges Ziel auch darin, den einen und anderen Mythos zu entzaubern und bestehende Hypothesen kritisch zu hinterfragen.
Die Forschungsergebnisse wurden dann 1994 in einem Buch veröffentlicht, das zusammen mit den Gedenktafeln vor allem einige Schlaglichter auf die Wirtschaftsgeschichte Passaus wirft.
Erschienen 1994 als Band 3 in der Reihe: „Der Passauer Wolf. Veröffentlichungen zur Kulturgeschichte Passaus“, herausgegeben von Max Brunner und Richard Schaffner, 77 S., 40 Abb.
Neben einer Fülle neuer Erkenntnisse zur Geschichte, der wechselnden Baugestalt - soweit sich diese anhand von Quellenmaterial und Akten des Bauamtes nachvollziehen und belegen läßt - sowie zur Geschichte bedeutender Bewohner, bestand ein wichtiges Ziel auch darin, den einen und anderen Mythos zu entzaubern und bestehende Hypothesen kritisch zu hinterfragen.
Die Forschungsergebnisse wurden dann 1994 in einem Buch veröffentlicht, das zusammen mit den Gedenktafeln vor allem einige Schlaglichter auf die Wirtschaftsgeschichte Passaus wirft.
Erschienen 1994 als Band 3 in der Reihe: „Der Passauer Wolf. Veröffentlichungen zur Kulturgeschichte Passaus“, herausgegeben von Max Brunner und Richard Schaffner, 77 S., 40 Abb.

In der Endphase meines Studiums ergab sich die Möglichkeit
mit Dr. Andreas Roser vom Lehrstuhl für Philosophie in Passau eine
bis dato unbekannte Vorlesungsnachschrift zu einer Vorlesung Schellings
zu editieren. Meine Aufgabe war vor allem das Entziffern der Handschrift
zur Überführung in eine Textdatei sowie weitere zur Edition notwendige
Arbeiten.
Schellings Vorlesung zur "Philosophie der Mythologie" in Berlin ist bekannt, wobei Schelling dort mehrfach betonte, er trage nichts anderes vor, als bereits in München. Die in Passau aufgefundene Vorlesungsnachschrift weicht substantiell nicht von der Berliner Vorlesung ab, aber - so formuliert Ehrhardt in seinem Vorwort - sie ist im Gedankengang klarer und sie erlaubt es, in präziseren Formulierungen die Gedanken Schellings neu nachzuvollziehen. Der Name des "verständigen" Schülers ist leider unbekannt.
Erschienen 1996 im Holzboog-Verlag, Band 6 der Reihe "Schellingiana".
Schellings Vorlesung zur "Philosophie der Mythologie" in Berlin ist bekannt, wobei Schelling dort mehrfach betonte, er trage nichts anderes vor, als bereits in München. Die in Passau aufgefundene Vorlesungsnachschrift weicht substantiell nicht von der Berliner Vorlesung ab, aber - so formuliert Ehrhardt in seinem Vorwort - sie ist im Gedankengang klarer und sie erlaubt es, in präziseren Formulierungen die Gedanken Schellings neu nachzuvollziehen. Der Name des "verständigen" Schülers ist leider unbekannt.
Erschienen 1996 im Holzboog-Verlag, Band 6 der Reihe "Schellingiana".
Startseite
I Publikationen
I Malerei
I Musik
I Foto
I "Neue" Medien
I Diverses
I Über mich